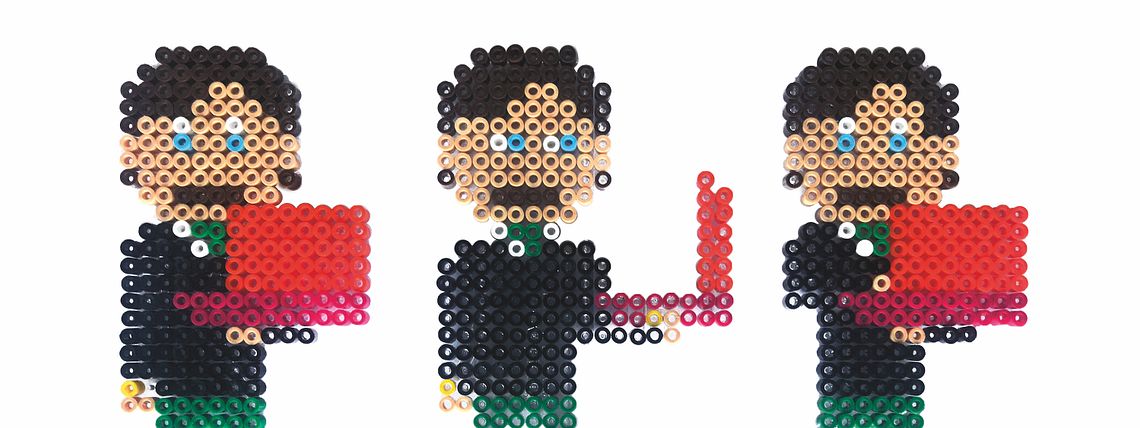ESSAY
EINMAL DIGITAL UND RETOUR BITTE
von Miguel Chau
Gemäss der klassischen Physik ist die Realität analog. Gemeint ist, dass Signale wie Licht und Ton glatte Funktionen sind – sie sind stufenlos und breiten sich durch ein «unendlich genaues» Raum-Zeit-Kontinuum aus. Doch die klassische Physik und die Mathematik behalten diesen Luxus der Vollkommenheit für sich. Betrachten wir als einfacheres Beispiel für diese Vollkommenheit statt einem Signal die Kreiszahl π. Wollen wir π konkret berechnen, um den Wert im Computer zu speichern, stellen wir fest, dass wir uns immer mit einer Annäherung begnügen müssen, weil π unendlich viele Nachkommastellen hat, die sich nicht periodisch wiederholen. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich in den Ferien auf einem Strassenmarkt eine Rolex kauft – das ungeübte Auge mag sich vielleicht täuschen lassen, aber wie wir alle wissen: Es ist nicht die echte Uhr.
Bereits die Griechen beschäftigten sich mit den Dezimaldarstellen von π. Sie mussten enttäuscht gewesen sein, als sie nach langem Probieren erkannten, dass sich weder die Kreisfläche noch die meisten Wurzeln als ganzzahlige Brüche schreiben lassen. Die Kreiszahl lässt sich nicht als Verhältnis zweier Zahlen schreiben, ist also keine Ratio (Bruch), und verdankt dieser Tatsache ihre Kategorisierung: irrationale Zahl. Aber nicht nur Archimedes, Heron von Alexandria, Euklid, und wie sie alle heissen, beschäftigten sich damit, wie man Zahlen wie die Kreiszahl π, die Diagonale des Einheitsquadrats √2 oder den goldenen Schnitt Φ berechnen kann. Nein, auch viele Jahrhunderte später trafen geistige Giganten wie Newton, Leibniz, Euler, Lagrange und Gauss (mit diesen beiden Sätzen haben wir das Namedropping-Budget der LGazette wohl ausgeschöpft) auf die Problematik, konkrete Zahlenwerte zu berechnen, als sie sich mit den Lösungen von Differenzialgleichungen und Integralen auseinandersetzten.
Für Theoretiker, die in Welten voller Ideale leben, mögen solche Probleme banal erscheinen und man lässt π einfach so stehen. Aber für Ingenieure, die Hochhäuser bauen oder Satelliten in den Orbit schiessen, ist π nicht nur ein mathematisches Ideal, sondern halt eben ca. 3.14159265359…. Und zum Glück interessierten sich auch viele angewandte Mathematiker für die Berechnung konkreter Zahlen und begründeten damit ein Teilgebiet innerhalb der Mathematik, das unter dem Namen numerische Mathematik, oder kurz Numerik, bekannt ist. Eine für die meisten wohl eher trockene Angelegenheit, aber ein paar Begeisterte erfreuen sich daran, kleine, unvollständige Brocken aus der Welt der mathematischen Ideale für uns fassbar zu machen.
Wenn man sich nun hinsetzt und „dem Teufel ein Ohr abrechnet“, um noch mehr Stellen von π zu eruieren, stellt man schnell fest, dass dabei viele repetitive mathematische Operationen durchgeführt werden müssen. Der Wunsch liegt also nahe, diese Prozesse irgendwie zu automatisieren. Genau dies war die Hauptmotivation, um Rechenmaschinen zu konstruieren. Nach verschiedenen Versuchen kristallisierte sich heraus, dass Techniken, die Signale analog speichern, zu instabil und empfindlich sind. Es ist deutlich einfacher, mit Maschinen zu hantieren, die klar und eindeutig funktionieren.
Um die Problematik ein bisschen zu verdeutlichen: Würde man eine Grösse in einem analogen Format speichern wollen, könnte man beispielsweise einen Messbecher mit Wasser füllen. Dieser könnte eine Zahl präzise erfassen. Allerdings ist dies ein instabiles Format. Wasser dehnt sich aus und zieht sich zusammen, es verdunstet und wenn wir es in einen anderen Messbecher leeren wollen, um damit zu rechnen, werden wir vermutlich den einen oder anderen Tropfen verlieren. 527 ml sind übermorgen vielleicht noch 525 ml. Einfacher ist es, fixe und klar unterscheidbare Zustände zu beurteilen: Ist der Becher voll oder leer? Es dürften sogar mehr als zwei Zustände sein. Wichtig ist, dass die Zustände eindeutig sind und eine kleine Fluktuation nicht zu einer anderen Interpretation führt – verliert man einen Tropfen, ist der Becher immer noch voll. Speichert man einen Wert auf solche Weise, so können wir viel einfacher und fehlerfreier damit hantieren.
Doch die klar unterscheidbaren Zustände bringen ein Problem mit sich: Wir müssen entscheiden, wie viele Becher wir zum Beispiel der Zahl π zur Verfügung stellen wollen. Je mehr Becher, umso präziser können wir die Zahl speichern. Für das Ideal bräuchten wir jedoch unendlich viele Becher.
Der stabile, aber endliche Speicher ist nicht nur für irrationale Zahlen ein Problem. Wollen wir eines der eingangs erwähnten kontinuierlichen Signale digital speichern, stehen wir vor einer ähnlichen Herausforderung. Denn es steht nur endlich viel Speicherplatz zur Verfügung. Es ist also nicht möglich, alle Werte, die ein kontinuierliches Signal annimmt, zu speichern, wir müssen uns mit endlich vielen Werten begnügen. Es stellt sich unmittelbar die Frage: Wie viele Werte sollen es sein? Unabhängig von der genauen Zahl beobachten wir, dass es endlich viele Werte sein müssen. Das gleiche Problem haben wir in allen Dimensionen! Wir müssen nicht nur die Anzahl der Stücke festlegen, sondern auch, wie präzise wir die Werte des Signals speichern wollen.
Der mathematische Fachbegriff für den Vorgang, ein kontinuierliches Objekt mit endlich vielen Werten zu beschreiben, heisst Diskretisierung. Dabei wird ein kontinuierliches Signal in fixen Abständen, an so genannten Stützstellen, abgetastet. Die Entscheidung, wie präzise das Signal gespeichert werden soll, läuft dann darauf hinaus, dass die an den Stützstellen gemessenen, „unendlich genauen“ Werte auf die nächste tatsächlich speicherbare Zahl gerundet werden. Der Fachbegriff dafür lautet Quantisierung. Um ein kontinuierliches Signal im Computer zu speichern, wird es daher sowohl diskretisiert als auch quantisiert. Diesen Prozess nennt man Digitalisierung.
Wir wollen diese doch eher abstrakte Beschreibung der Digitalisierung anhand eines malerischen Sonnenuntergangs veranschaulichen: Der Himmel färbt sich in wunderbarem Abendrot. Wir sehen einen Farbverlauf von leuchtendem Orange-Rot bis zu tiefem Blau. Doch wie viele Farben sind das eigentlich zwischen den Extremen? Das Farbspektrum ist zwar begrenzt durch tiefes Blau und leuchtendes Orange-Rot, aber der Farbverlauf ist kontinuierlich – die klassische Annahme ist, dass es dazwischen unendlich viele Nuancen gibt. Wenn man dann aber den Sonnenuntergang mit einer Digitalkamera festhält, sammelt die Kamera in jedem Bildpunkt (Pixel) Licht und berechnet einen konkreten Farbwert. Den Raum in ein fixes Raster aus Bildpunkten aufzuteilen, ist der Diskretisierungs-Schritt: Während die Blende geöffnet ist, sammelt nun jeder Bildpunkt Licht und rundet den gemessenen Wert auf eine speicherbare Zahl. Dies ist die Quantisierung. Je mehr Bits («Becher») wir benutzen, um den Wert eines Bildpunkts zu speichern, umso mehr Farben können wir repräsentieren. Die Anzahl Bits, mit der man einen Farbwert speichert, heisst Farbtiefe. Speichert man zum Beispiel jeden der drei Farbkanäle (Rot, Grün und Blau) in einem Byte (8 Bits), also 24 Bits insgesamt, so kann man 2^24 unterschiedliche Farbwerte unterscheiden. Das sind ein bisschen weniger als 17 Mio. verschiedene Farben. Das ist eine enorme Farbpalette. Trotzdem gehen unendlich viele Nuancen der analogen Realität verloren.
Aber wenn die analoge Realität so unendlich vollkommen ist, wieso hören wir dann nicht nur Vinylplatten und stellen das Radio von UKW (Ultrakurzwellen) auf DAB (Digital Audio Broadcasting) um? Man könnte zwar einwenden, dass Nostalgiker, die das Knistern der Schallplatten und die natürliche Unschärfe in Fotos zu schätzen wissen, durchaus noch analoge Technologien benutzen. Aber kaum jemand wird in Frage stellen, dass sich in der breiten Masse digitale Technologien durchgesetzt haben. Und es gibt gute Gründe, wieso das so ist. Digitalisierung nimmt den Präzisionsverlust in Kauf, bietet aber dafür eine enorme Flexibilität: Zum Beispiel lassen sich digitale Güter identisch und kostengünstig vervielfältigen. Man stelle sich vor, wie viele Schallplatten notwendig wären, damit alle Menschen jederzeit die Musik hören könnten, die sie gerade wünschen. Digitale Güter sind zudem leichter zu transportieren, denn sie benötigen kaum physischen Platz. Wenn wir alle Texte, die sämtliche Bücher enthalten, digital abspeicherten, bräuchte es nicht einmal einen Kubikmeter an Festplatten. Die eigentlichen physischen Bücher hingegen würden auch mit den dünnsten Seiten und einer unanständig kleinen Schriftgrösse mehrere Gebäude füllen – und dann hätten wir sozusagen erst eine Kopie von jedem Buch. Andere offensichtliche Vorteile von digitalen Objekten gegenüber analogen sind beispielsweise die Übertragungsgeschwindigkeit von Information oder dass Signale störungsfrei reproduziert werden können. All diese praktischen Eigenschaften machen Informationen handlich und tragen so zur Demokratisierung und Zugänglichkeit des Wissens bei, was wiederum wissenschaftlichen Fortschritt und ein besseres Leben für Milliarden von Menschen ermöglicht.
Doch es soll auf keinen Fall der Eindruck vermittelt werden, dass digitale Objekte «besser» seien als analoge. Die Schönheit und Vollkommenheit analoger Objekte sind auf unzertrennliche Weise an die Tatsache gekoppelt, dass diese Objekte eben analog sind und die digitalisierte Version wird nie mehr als ein unwürdiges Abbild dieser Vollkommenheit sein. Natürlich kann man auf einem E-Book-Reader mehr Texte speichern, als man Bücher zu tragen vermag. Aber alle E-Book-Reader der Welt werden niemals das Gefühl des Umblätterns vergilbter Reclam-Seiten oder den Geruch und die Textur einer LGazette ersetzen können. Und genauso könnte man, statt sich den Kopf über die Stellen von π zu zerbrechen, sich an einem Zirkel erfreuen, der die Kreiszahl in ihrer ganzen Vollkommenheit in sich trägt, ohne auch nur eine einzige Ziffer preiszugeben.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass es aber nicht nur die Nostalgie ist, die uns zu analogen Technologien zurückführt. Es werden auch aus praktischen Gründen immer wieder Versuche unternommen, um analoge Rechenmaschinen zu konstruieren. Und das mit Erfolg! Für gewisse Arten von Algorithmen, bei denen Rauschen und kleine Fluktuationen kein Problem darstellen, ist es durchaus sinnvoll, analoge Bauteile zu benutzen. Dabei nimmt man aber keine Messbecher, sondern macht sich die physikalischen Eigenschaften von Strom und elektrischen Bauteilen zunutze. Eine konkrete Anwendung solcher analogen Bauteile findet man zum Beispiel bei künstlichen neuronalen Netzen, die seit etwa einem Jahrzehnt in aller Munde sind und das Gebiet des maschinellen Lernens revolutionieren. Dabei pendeln sich die Netzwerke auf stabilen Werten ein, wobei die konkrete Zahl gar nicht unbedingt in Erfahrung gebracht werden muss, um damit weiterzurechnen. Oft werden diese analogen Bauteile mit digitalen kombiniert, sodass hybride Systeme entstehen (siehe QR). Diese können die Berechnungen in der jeweils geeigneteren Architektur ausführen und vereinen damit «das Beste aus beiden Welten».
Es ist völlig sinnfrei, beim Thema «Analog vs. Digital» eine Partei zu ergreifen. Man schränkt sich bloss künstlich ein, wenn man sich der Digitalisierung verweigert oder die Vollkommenheit und die Vorteile analoger Objekte nicht zu schätzen weiss. Dies zu tun wäre einfältig und ideologisch – oder wie mein Professor für Datenstrukturen und Algorithmen zu sagen pflegte: «Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel». Es geht nicht darum, die digitale Welt gegen die analoge abzuwägen. Vielmehr sollte man sich die Vor- und Nachteile jeweils bewusst machen, um einen fundierten Entscheid zu fällen, welches Medium sich wann besser eignet. Digitalisierung sollte als Bereicherung und Ergänzung zur analogen Realität verstanden werden, die uns eine Vielfalt an Möglichkeiten und Freiheiten bietet. Mit dieser verantwortlich umzugehen, ist die grosse Herausforderung.
Miguel Chau unterrichtet am LG Informatik.
Illustration: Anouk Brunner und Amelia Columberg